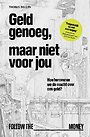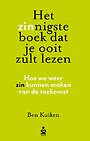Gegenstand der Untersuchung.- Eingrenzung des Untersuchungsobjektes.- Seine betriebswirtschaftliche Bedeutung.- Aufgaben des Betriebswirtes.- Bedeutung der technischen Gegebenheiten.- Der Produktionsapparat als Bestimmungsfaktor für wirtschaftliche Entscheidungen.- Das gewinnmaximale Produktionsprogramm.- Die betriebswirtschaftlichen Entscheidungsbereiche.- Die unterschiedliche Eindeutigkeit quantitativer betriebswirtschaftlicher Aussagen.- Erstes Kapitel Die Produktionsgeschwindigkeit.- 1. Zur Geschichte des Begriffes „Produktionsgeschwindigkeit“.- Die Produktionsgeschwindigkeit bei Stackelberg.- Der Inhalt des Begriffs in dieser Untersuchung.- Die Wurzeln des Begriffes Gschwindigkeit.- 2. Die Geschwindigkeit als physikalischer Begriff.- Definition der physikalischen Geschwindigkeit.- Physikalische Dimension der Geschwindigkeit.- Die Bedeutung der Gleichförmigkeit.- Die Momentangeschwindigkeit.- Die Bestimmtheit des Weges aus der Zeit und der Momentangeschwindigkeit.- Die Durchschnittsgeschwindigkeit.- Die Zeit/Weg-Dimension der Geschwindigkeit.- Das allgemeine Wesen des Begriffes Geschwindigkeit.- Die allgemeinen Dimensionen der Geschwindigkeit in der Produktion.- 3. Die Geschwindigkeit als Begriff in der Produktion.- Jeder Vorgang vollzieht sich in der Zeit.- Stackelbergs Definition der Produktionsgeschwindigkeit.- Das Wesen der Produktionsgeschwindigkeit bei Stackelberg.- 4. Die Produktionsgeschwindigkeit in der betrieblichen Wirklichkeit.- Die zwei Hauptmängel der durchschnittlichen Produktionsgeschwindigkeit.- Das Problem der Quantifizierung der Produktionsgeschwindigkeit bei Mehrproduktbetrieben.- Die Produktionsgeschwindigkeit eines Betriebes als heterogenes Phänomen.- Der Begriff der homogenen Produktionsgeschwindigkeit.- Die homogene Produktionsgeschwindigkeit als Wesensmerkmal betrieblicher Elementareinheiten und Elementarvorgänge.- Der Elementarvorgang als kleinste funktionale Einheit.- Technische Unterbegriffe der Produktionsgeschwindigkeit.- Die menschliche Normalleistung als Unterbegriff der Produktionsgeschwindigkeit.- 5. Die Substituierbarkeit von Zeit und Geschwindigkeit.- Zeit und Geschwindigkeit sind austauschbar.- Zeit ist Geld!.- Geschwindigkeit kostet Geld.- Produktionsdauer und Produktionsgeschwindigkeit als Substitutionsfaktoren.- Die Zeit/GeschwindigkeitIndifferenzkurve.- Zweites Kapitel Produktionsgeschwindigkeit und Kostenfunktion.- 1. Allgemeine Ausgangspunkte der Untersuchung.- Der Elementarvorgang als Untersuchungsobjekt.- Die erforderlichen Nebenbedingungen.- Der Idealfall.- Die betrieblichen Verhältnisse.- 2. Kosten und Produktionsgeschwindigkeit bei einem Turbogenerator.- Der Turbogenerator als Idealfall.- Die Versuchsbedingungen.- Das Ergebnis: Die kubisch-parabolische Kostenkurve.- Fixe und variable Kosten.- Die Vermutung der Allgemeingültigkeit der Kostenfunktion.- 3. Über die Gesetzmäßigkeiten der Kostenfunktion.- Die mathematische Struktur der Kostenfunktion.- Der typische Verlauf der Kostenkurve.- Abnehmende Grenzkosten.- Zunehmende Grenzkosten.- Auswirkungen auf die Stückkosten.- Reihenfolge der Minima.- Die erforderliche Bereinigung der Meßwerte.- Die Stückkostenkurven.- Die Bedeutung der Kostenfunktion bei einem Turbogenerator.- Die graphische Darstellung der kostenminimalen Produktionsgeschwindigkeiten.- 4. Das Wesen der Kostenfunktion.- Das Zustandekommen der Kostenfunktion.- Die Unabhängigkeit der einzelnen Produktionsgeschwindigkeiten.- Die Bedeutung der Produktionsdauer.- Der lineare Anstieg der Kosten mit der Produktionsdauer.- Die Kostenfunktion als Ergebnis einer Aneinanderreihung von Kostensäulen.- Die Konstanz der variablen Stückkosten bei konstanter Produktionsgeschwindigkeit.- Die konstanten Grenzkosten.- Der lineare Kostenverlauf eines Betriebes als notwendige Folge der Kostenfunktion.- 5. Die Dimensionen der Kostenfunktion.- Die Produktionsgeschwindigkeit als Momentangeschwindigkeit.- Die Unabhängigkeit ihrer Dimension von der Produktionsdauer.- Die Produktionsdauer als wesentlicher Bestandteil der Dimension der Kosten.- Die Unabhängigkeit der Abszissen-Skala.- Eine begriffliche Schwierigkeit der Kostenfunktion.- Die statische Kostenfunktion?.- Die Zusammenhänge zwischen Produktionsgeschwindigkeit und Produktionsdauer.- Produktionskosten und Produktionsgeschwindigkeit mit gleichen Zeiteinheiten.- Die Abhängigkeit der Kostenfunktion von der Produktionsdauer.- Die Hauptbedingungen der Kostenfunktion.- 6. Produkteigenschaften als Determinanten der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Variationsbreite der Produktionsgeschwindigkeit.- Einkaufstaktisch bedingte Forderungen.- Physikalische Meßtechnik und chemische Analysentechnik als Instrumente wirtschaftlicher Ziele.- Die Produkteigenschaften determinieren die Produktionsceschwindigkeit.- 7. Die vereinfachte empirische Ermittlung der Kostenfunktion.- Technische und wirtschaftliche Hindernisse.- Die Kosten der Ermittlung der Kostenfunktion.- Die betriebsgewöhnlichen Produktionsgeschwindigkeiten.- Die Irrelevanz des Bereichs der abnehmenden Grenzkosten.- Das Kurvenstück der zunehmenden Grenzkosten.- Die allgemeinen Eigenschaften der Kostenfunktion.- Die wahrscheinliche Allgemeingültigkeit der Kostenfunktion.- Die Bedeutung des vollständigen Variationsbereichs der Produktionsgeschwindigkeit.- 8. Die Messung der Produktionsgeschwindigkeit.- a) Über die verschiedenartigen Dimensionen der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Notwendigkeit verschiedenartiger Dimensionen der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Dimension der kostenminimalen Produktionsgeschwindigkeit.- Die Dimension der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeit.- Die technische Dimension der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Relationen zwischen allen drei Dimensionen.- Ihre Bedeutung für Standardkostenrechnungen.- Die Meßbarkeit der Produktionsgeschwindigkeit.- Kontinuierliche Produktionsvorgänge mit meßbaren Momentangeschwindigkeiten.- Kontinuierliche Produktionsvorgänge ohne meßbare Momentangeschwindigkeiten.- Diskontinuierliche Produktionsvorgänge (Chargenprozesse).- b) Kontinuierliche Produktionsvorgänge ohne kontinuierlich meßbare Produktionsmengen.- Die Relation zwischen den einzelnen Dimensionen der Produktionsgeschwindigkeit als Funktion der technischen Dimension.- Die Maximalkapazität.- c) Chargenprozesse.- Typische Merkmale der Chargenprozesse.- Der tendenzielle Rückgang der Chargenprozesse.- Die Verminderung der Anzahl der homogenen Produktionsgeschwindigkeiten.- Das Wesensmerkmal des Chargenprozesses: Kombination einer Elementareinheit mit mehreren Elementarvorgängen.- Die Unabhängigkeit der einzelnen Produktionsgeschwindigkeiten.- Spezielle Probleme bei Chargenprozessen.- Besonderheit der Produktionsgeschwindigkeit bei Chargenprozessen.- Nur Angabe von Durchschnittsgeschwindigkeiten möglich.- Die Schwierigkeiten bei der Verifizierung der Kostenfunktion.- d) Die durchschnittliche Produktionsgeschwindigkeit.- Errechnung der durchschnittlichen Produktionsgeschwindigkeit.- Bei Chargenprozessen keine Momentangeschwindigkeiten meßbar.- Auch bei Chargenprozessen Momentangeschwindigkeiten.- Ein Beispiel: Brotbacken.- Die Kosten sind immer eine Funktion der Momentangeschwindigkeiten.- Nebenbedingungen für die Eindeutigkeit der Kostenfunktion bei Chargenprozessen.- Die wirtschaftliche Verfahrensweise.- Die Bedeutung der Gleichförmigkeit der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Summierung der Kosten bei variierenden Produktionsgeschwindigkeiten.- 9. Die Kostenfunktion einer Papiermaschine und eines Zellstoffkochers.- a) Die Kostenfunktion einer Papiermaschine.- Ein interessantes kostentheoretisches Phänomen.- Der Stoff als Minimumfaktor.- Die Antriebsverhältnisse als Minimumfaktor.- b) Die Kostenfunktion eines Zellstoffkochers.- Die Bestimmungsgrößen von Kosten und Produktionsgeschwindigkeit beim Holzaufschluß.- Die Schwierigkeiten beim Chargenprozeß.- 10. Die Meßbarkeit der Kosten.- Die Kosten als Meßproblem.- Die Meßbarkeit, eine Funktion der Produktionsdauer.- Nutzungsdauer und Instandhaltungskosten als Hauptproblem.- Die Irrelevanz der Schätzungsfehler.- Die Mengenkomponente der Kosten.- Die Wertkomponente.- Die Produktionsgeschwindigkeit als Variabilitätsfaktor der Wertkomponente.- Die Abhängigkeit der Kostenfunktion von den Bedingungen auf den Beschaffungsmärkten.- 11. Zur Deutung der Kostenfunktion.- Die grundlegende Allgemeingültigkeit der Kostenfunktion.- Eine Ausnahme.- Die Kostenfunktion, ein empirisches Phänomen.- 12. Die Produktionsgeschwindigkeit bei der menschlichen Arbeit.- Keine kubisch-parabolische Kostenfunktion.- Die Entlohnungsform als Bestimmungsgrund der Kostenfunktion.- Der Energieumsatz beim Menschen.- Der multiplizierte Einsatz menschlicher Arbeitskraft.- Die Meßbarkeit der menschlichen Arbeitsleistung.- Drei Grundformen der Entlohnung.- Zeitlohn.- Akkordlohn.- Prämienlohn.- Der Elementarvorgang vom Typ A.- Der Elementarvorgang vom Typ B.- Die Mischung der Elementarvorgänge im Zeitablauf.- Die Kostenfunktion beim Zeitlohn.- Die Kostenfunktion bei Akkordlohn beim Elementarvorgang vom Typ A.- Die Kostenfunktion bei Akkordlohn beim Elementarvorgang vom Typ B.- Der Prämienlohn.- Das Problem des Prämienlohnes.- Die besonderen Beziehungen zwischen der menschlichen Arbeit und ihrer Produktionsgeschwindigkeit.- Drittes Kapitel Produktionsgeschwindigkeit, Kapazität und Beschäftigungsgrad.- 1. Die Abhängigkeit der Kapazität von der Produktionsgeschwindigkeit.- Die branchenübliche Arbeitszeit.- Die Kapazität als Funktion von Arbeitszeit und Produktionsgeschwindigkeit.- Die Gesamtkapazität eines Betriebes als Näherungsgröße.- Zeiteinheit und Kalenderzeiteinheit.- Die betriebswirtschaftliche Kapazität.- Die technische Kapazität.- Die maximale Produktionsgeschwindigkeit.- Der Vorrang der wirtschaftlichen Kapazität.- Der Engpaß.- 2. Die Abhängigkeit des Produktionsvolumens von der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Grenzen des Produktionsvolumens.- Die Bestimmungsgrößen des Produktionsvolumens.- Die Problematik seiner Meßbarkeit.- 3. Der Beschäftigungsgrad.- Das realisierte Produktionsvolumen.- Die Bestimmungsgrößen des Beschäftigungsgrades.- 4. Die Abhängigkeit der Kosten vom Beschäftigungsgrad.- Keine Gesetzmäßigkeiten bei quantitativer und zeitlicher Anpassung.- Die unternehmerischen Dispositionen als Bestimmungsgründe.- Die zeitlichen Dispositionsüberlagerungen.- Die Erwartungsgrößen als eigentliche Bestimmungsgründe.- Unternehmerdispositionen als unmittelbare Kostendeterminanten.- Die dispositionsbestimmenden Größen.- Die zeitliche Vorhersehbarkeit.- Der erwartete Umfang der Beschäftigungsänderung.- Die erwartete Dauer der Beschäftigungsänderung.- Das subjektive Moment aller Dispositionen.- Kostenmäßige Nachwirkungen und Vorwirkungen bei Anpassungsdispositionen.- Die Variabilität der Bestimmungsgründe der Anpassungsdispositionen.- Die eigentliche Unternehmeraufgabe.- 5. Sprungkosten und Kostenremanenz.- Die Kostenfunktion ist stetig.- Sie kennt weder Sprungkosten noch eine Kostenremanenz.- Beide sind dispositionsbestimmte Phänomene zeitlicher und quantitativer Anpassung.- Die permanente Bedeutung der Kostenfunktion.- Viertes Kapitel Produktionsgeschwindigkeit und Gewinnmaximierung.- 1. Die instrumentale Bedeutung der Gewinnmaximierung.- Die instrumentale Bedeutung des Begriffes Gewinnmaximierung.- Seine ethische Neutralität.- Seine formale Notwendigkeit.- 2. Die allgemeinen Bestimmungsgründe der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeit.- Der reine Grenzfall der Einfachproduktion.- Die Ableitung der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeit.- Der Erlös und die variablen Kosten als Bestimmungsfaktoren der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeit.- Grenzkosten.- Grenzerlös.- 3. Die gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeiten bei zwei und mehr Elementareinheiten.- Der Regelfall.- Die Abhängigkeiten der Kostenfunktion bei Stufenproduktion.- Ein Beispiel.- Die Verbrauchsfunktion.- Die Verbrauchsgeschwindigkeit.- Die Beziehungen zwischen Produktionsgeschwindigkeit und Verbrauchsgeschwindigkeit eines Vorproduktes.- Die Bedeutung der variablen Kosten.- Der zeitliche Spielraum.- Die Bedeutung des Engpasses.- Der Engpaß als Bestimmungsfaktor der Grenzkosten und der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeit.- 4. Die Interdependenz der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeiten.- Der Chargenprozeß in der Einfachproduktion als Modellfall.- Mehrere Elementarvorgänge und eine Elementareinheit.- Die Substituierbarkeit von Zeit und Geschwindigkeit bei Chargenprozessen.- Die Bestimmungsgründe für die Interdependenz der gewinnmaximalen Produktionsgeschwindigkeiten.- Ein Erlös gegenüber drei Kostenfunktionen.- 5. Das gewinnmaximale Produktionsprogramm.- Keine neuen Probleme gegenüber der Einfachproduktion.- Nur eine Anhäufung.- Die Anzahl der Engpässe als Hauptfaktor.- Der komplizierteste Grenzfall der Mehrfachproduktion.- Die totale Interdependenz der Produktionsgeschwindigkeiten aller Elementarvorgänge.- Die lineare Programmierung.- Fünftes Kapitel Produktionsgeschwindigkeit und Ertragsgesetz.- 1. Die Frage des Ertragsgesetzes in der Industrie.- Die Frage nach der Verwandtschaft zwischen Kostenfunktion und Ertragsgesetz.- Bisherige Auffassungen.- Richtung unserer Analyse.- 2. Die wirksame Ursache bei der Variierung der Produktionsgeschwindigkeit.- a) Die Energie als Elementarfaktor der Produktion.- Wie lassen sich Produktionsgeschwindigkeiten steigern?.- Die Energiezufuhr als causa efficiens.- Die Rolle der Energie im Produktionsprozeß.- Erkenntnisse der Philosophen und Naturwissenschaftler.- Das Kausalitätsprinzip.- Der Zusammenhang zwischen Kraft und Geschwindigkeit.- Die Technokraten.- Die Energie als Elementarfaktor.- Die funktionale Betrachtung anstelle der substantiellen.- b) Die Energieformen.- Überblick über die Formen der Energie.- Die Umwandelbarkeit der Energieformen.- Umwandelbarkeit nur auf Umwegen.- Die Energie-wirtschaft in der Industrie.- Die menschliche Muskelenergie.- Die animalische Muskelenergie.- Die mechanische Energie.- Die Wärmeenergie.- Die elektromagnetische Energie.- Die Strahlenenergie.- Die chemische Energie.- Die Atom- oder Kernenergie.- 3. Die Produktionsapparatur als Elementarfaktor der industriellen Produktion.- Das Verhältnis von Arbeitsproduktivität und Energieeinsatz.- Die Entdeckung der Energiequellen.- Die Erfindung der Kraftmaschinen.- Die Erfindung der Arbeitsmaschinen.- Die Funktion der Maschinen oder der Apparatur.- Die Grenze der apparativen Fähigkeiten.- Der Dampfkesselüberwachungsverein.- 4. Der Einsatzstoff als Elementarfaktor der industriellen Produktion.- Der Einsatzstoff als Objekt.- Seine Bedeutung in der Kostenfunktion.- Seine Besonderheit bei chemischen Produktionsvorgängen.- Direkte Energie und Einsatzstoffe als Energieträger.- 5. Die menschliche Arbeit als Elementarfaktor der industriellen Produktion.- Die mehrfachen Formen menschlicher Arbeit.- Der Mensch als Träger der Energiefunktion.- Der Mensch als Träger maschineller Funktionen.- Die Steuerungsfunktion als Wesenselement menschlicher Arbeit.- Mechanisierbare Steuerungsfunktionen.- Kein Elementarvorgang ohne menschliche Steuerung.- 6. Die Elementarkombinationen der Elementarfaktoren in der industriellen Produktion.- Zwei oder mehr Faktorenfunktionen bei einem Funktionsträger.- Die Faktorträgerkombinationen.- Die Bedeutung der Elementarvorgänge.- Die erste Elementarkombination: Jeder Elementarfaktor tritt als Funktionsträger auf.- Die zweite Elementarkombination: Der Einsatzstoff ist Träger der Energiefunktion.- Die dritte Elementarkombination: Umwandlung direkter Energieformen (kein Einsatzstoff).- Die vierte Elementarkombination: Der Mensch als Träger der Energiefunktion.- Die fünfte Elementarkombination: Der Mensch als Träger der Energiefunktion und als Träger der apparativen Funktion.- Die vier Elementarfaktoren in der Praxis: Anlagenwirtschaft, Personalwirtschaft, Energiewirtschaft, Stoffoder Materialwirtschaft.- 7. Die Elementarfaktoren der landwirtschaftlichen Produktion.- Die Unterschiede zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Produktion.- Auch in der Industrie biologisch bedingte Produktionsvorgänge.- Auch in der Landwirtschaft mechanische Produktionsvorgänge.- Das Gesetz vom abnehmenden Bodenertragszuwachs.- Nur für Anbau autotropher Pflanzen.- Das Wesen des Anbaues autotropher Pflanzen.- Der biologische Wachstumsprozeß.- Die Sonne als direkte Energiequelle.- Die Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen.- Die menschliche Arbeit als Elementarfaktor der landwirtschaftlichen Produktion.- Der Boden als Parallele zur Produktionsapparatur.- Der Stoffeinsatz.- Die drei typischen Formen des Stoffeinsatzes.- Der Anbau autotronher Pflanzen in der Elementarkombination K I.- 8. Typische Eigenheiten landwirtschaftlicher Produktionsvorgänge.- Die Sonne als Energiequelle.- Die Unbeeinflußbarkeit der Energie-zufuhr.- Landwirtschaftliche Produktionsergebnisse lassen sich nicht beliebig reproduzieren.- Die Freiheitsgrade in der Landwirtschaft.- Die Assimilation.- Die Unbeeinflußbarkeit des CO2 und der Niederschläge.- Die unvorhersehbaren Variationen der unbeeinflußbaren Faktoren.- Bedeutung der Wettervorhersage.- Das Produktionsrisiko in der Landwirtschaft.- Die Industrialisierung der Landwirtschaft.- Ein bleibendes typisches Merkmal der Landwirtschaft: Der Chargenprozeß.- 9. Typische Eigenheiten chemischer Produktionsvorgänge.- Die Sonderstellung chemischer Vorgänge in der industriellen Produktion.- a) Chemische Produktionsprozesse.- Die Stoffumwandlung als chemischer Vorgang.- Auch mechanische Produktionsvorgänge in der chemischen Industrie.- Der Ablauf der Produktion in der Chemie.- Chemische Vorgänge in allen Industriezweigen, ebenso in der Landwirtschaft.- Das Wesen chemischer Vorgänge.- b) Die Reaktionsgeschwindigkeit.- Die chemisch-technische Dimension der Produktionsgeschwindigkeit.- Die Bestimmungsfaktoren der Reaktionsgeschwindigkeit.- Das energetische Wirkungspotential.- Der grundsätzliche Unterschied gegenüber mechanischen Vorgängen.- Das wirksame Energiepotential als allgemeine Determinante der Produktionsgeschwindigkeit.- Der energetische Wirkungsgrad.- Die Raumzeit / Ausbeute als technischer Begriff für die Produktionsgeschwindigkeit.- Katalysatoren und Produktionsgeschwindigkeit.- Der energetische Wirkungsgrad bei mechanischen Vorgängen.- Die Substitutionalität als typische Eigenheit chemischer Vorgänge.- Die Ähnlichkeit zwischen chemischen Produktionsvorgängen und Wachstumsvorgängen in der Landwirtschaft.- 10. Typische Eigenheiten mechanischer Produktionsvorgänge.- Die Funktionen der Maschine.- Die Maschine als zweckgerichtete Konstruktion.- Die Naturfremdheit mechanischer Produktionsabläufe.- Der Vergleich mit chemischen Produktionsvorgängen.- Die typische Eigenschaft mechanischer Produktionsvorgänge: Keine Substitutionalität der variablen Faktoren.- Die Definition der Maschine.- Die starre Bewegungsrichtung der Energie bei mechanischen Produktionsvorgängen.- Nur ein eindimensionaler Freiheitsgrad.- Die Funktionalität der Kosten.- Die besondere Eigenschaft der Energie.- Die initiale Variierbarkeit.- Die funktional bedingte Variierbarkeit.- Die typische Eigenheit mechanischer Produktionsvorgänge.- Die eindimensionale Variierbarkeit.- Die mathematische Formulierung.- 11. Das Gesetz von der zunehmenden initialen Variierbarkeit.- Die initiale Variierbarkeit bei chemischen Vorgängen.- Die Reihenfolge der wachsenden initialen Variierbarkeit.- Über die Ursächlichkeit dieser Reihenfolge.- Die Einengung der initialen Variierbarkeit durch finale Konstruktionselemente.- Das Verhältnis der Anzahl der Freiheitsgrade zur Anzahl der initial variierbaren Faktoren.- Die Elastizität der Produktionsvorgänge.- Größte Elastizität in biologischen Organismen.- Die physiologische Vikarianz = totale Substitutionalität.- Die Regelmäßigkeit biologischer Vorgänge.- Die Regellosigkeit mechanischer Vorgänge.- Entdecken und Erfinden.- 12. Kostenfunktion und Ertragsgesetz.- Die Ergebnisse Gutenbergs.- Seine Prämissen und seine Schlußfolgerungen.- a) Kostenfunktion und Ertragsgesetz bei eindimensional variierbaren Produktionsvorgängen.- Merkmale dieser Kostenfunktion.- Die Produktionsgeschwindigkeit als einzige Wahlmöglichkeit.- Die Eindeutigkeit der Kostenfunktion.- Produktionsgeschwindigkeit ist gleich Ertrag in der Zeiteinheit.- Die Ertragsfunktion als inverse Kostenfunktion.- Der Gültigkeits-bereich dieser Kosten- und Ertragsfunktion.- b) Kostenfunktion und Ertragsgesetz bei mehrdimensional variierbaren Produktionsvorgängen.- Die Substitutionsmöglichkeiten.- Die Minimalkostenkombination.- Ihre Merkmale.- Die Minimalkostenkombination bei der Konstruktion einer Anlage.- Mehrere Minimalkostenkombinationen.- Jede Produktionsgeschwindigkeit hat eine Minimalkostenkombination.- Die Kostenfunktion ist gleich den kostenminimalen Punkten aller Produktionsgeschwindigkeiten.- Die Substitutionalität variabler Faktoren hat nichts mit der Kostenfunktion zu tun.- Eigenheit der Kostenfunktionen: nicht funktional bestimmt, sondern dispositiv bestimmbar!.- Die Ertragsfunktion als inverse Kostenfunktion.- Der Ertrag keine eindeutige Funktion der Kosten.- Ertragskurve gleich den Maximalmengen-Punkten für jeden Kostenbetrag.- Die Substitutionalität der variablen Faktoren ohne Zusammenhang mit dem Ertragsgesetz.- Die allgemeine Formulierung des Ertragsgesetzes.- Die Irrtümer über das Ertragsgesetz.- Die Substitutionalität des Ertragsgesetzes.- Kostenfunktion und Ertragsgesetz als quantitative Darstellung der funktionalen Substitutionalität.- Die Differenzierung des Begriffes Substitutionalität.- Die initiale Substitutionalität.- Die funktionale Substitutionalität.- Die konjekturale Substitutionalität.- Die mutative Substitutionalität.- Die totale Substitutionalität.- c) Die empirische Kostenfunktion bei mehrdimensional variierbaren Produktionsvorgängen.- Das klassische Ertragsgesetz praktisch kaum brauchbar.- Die betriebswirtschaftlich relevanten Punkte.- Ein praktisches Beispiel.- d) Allgemeine Schlußfolgerungen.- Die Allgemeingültigkeit der Kostenfunktion und des Ertragsgesetzes.- Das Ertragsgesetz, ein betriebswirtschaftliches Phänomen, kein volkswirtschaftliches.- Das Verdienst Gutenbergs.- Die Linearität der Kosten und die Proportionalität der Grenzkosten bei mehrdimensional variierbaren Produktionsvorgängen.- Die Basis der Plankostenrechnung.- 13. Die Variationsformén der Elementarkombinationen.- Jeder Elementarfaktor in zwei Varianten.- Die einzelnen Variationsformen.- a) Die Variationsformen der Elementarkombination KI.- Sechzehn mögliche Variationsformen.- Die meisten Produktionsvorgänge in Industrie und Landwirtschaft.- b) Die Variationsformen der Elementarkombination KII.- Acht mögliche Variationsformen.- Der Stoff ist Energieträger.- c) Die Variationsformen der Elementarkombination KIII.- Acht mögliche Variationsformen.- Umwandlungen direkter Energieformen.- d) Die Variationsformen der Elementarkombination KIV.- Acht mögliche Variationsformen.- Der Mensch als Träger der Energiefunktion.- e) Die Variationsformen der Elementarkombination KV.- Vier mögliche Variationsformen.- Der Mensch als Träger der Energiefunktion und der maschinellen Funktion.- f) Einige Bemerkungen zu allen Variationsformen.- Sechstes Kapitel Zur kostenfunktionalen Morphologie des Industriebetriebes.- 1. Die kostenfunktionale Strukturanalyse des Industriebetriebes.- Das Produktionsprogramm als Bestimmungsfaktor für den Betriebsablauf.- Die unerwünschten Nebenwirkungen.- Die Bedeutung der Strukturanalyse.- Die Elemente der Strukturanalyse.- Die Aussagefähigkeit der Strukturanalyse.- 2. Grenzformen kostenfunktionaler Betriebsstrukturen.- Das Strukturbild des Betriebes.- Reine Betriebstypen als Modelle.- 3. Betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten beim reinen Betriebstyp des Elementarvorganges A.- Das Wesensmerkmal des Betriebstyps A.- Keine kubisch-parabolischen Kostenfunktionen.- Die Schwerpunkte bei der wirtschaftlichen Steuerung des Produktionsprozesses.- Die menschliche Arbeitsgeschwindigkeit.- Die Determinanten der menschlichen Arbeitsgeschwindigkeit.- Die Eigengesetzlichkeit der menschlichen Arbeit.- Die Eigenständigkeit des Arbeits und Zeitstudiums.- REFA.- Die hohe Elastizität dieses Betriebstyps.- Vor- und Nachteile der Elastizität.- 4. Betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten beim reinen Betriebstyp des Elementarvorganges B.- Merkmale des Betriebstyps B.- Die betriebswirtschaftlich relevanten Punkte der Kostenfunktion im Vordergrund.- Mathematische Methoden.- Der Einsatz von Rechenmaschinen.- 5. Die reinen Betriebstypen als Anfangs- und Endpunkte der technischen Entwicklung.- Der Beginn der technischen Entwicklung.- Der Mensch allein.- Die ersten Werkzeuge.- Die ersten Maschinen.- Das Rad als naturfremdes Maschinenelement.- Die Rolle der tierischen Energie.- Die Windund Wasserkräfte.- Die Erfindung der Dampfmaschine.- Der vollständige Ersatz der menschlichen Muskelenergie.- Die Atomenergie.- Die Automatisierung.- Die wachsende Bedeutung der Kostenfunktion.- Die wachsende Notwendigkeit mathematischer Methoden.- Schlußwort.- Die weiteren Forschungsaufgaben.- Die Wirklichkeit als Schiedsrichter.- Die Produktionsgeschwindigkeit als Ursprung vieler Probleme.- Die Richtigkeit der bisherigen Kostentheorie.- Die Bedeutung der technischen und naturgesetzlichen Grundlagen.- Die mathematische Darstellung.- Die Kosten- und Ertragstheorie als ein Abbild des Ordnungsgefüges der materiellen Welt.- Namenverzeichnis.